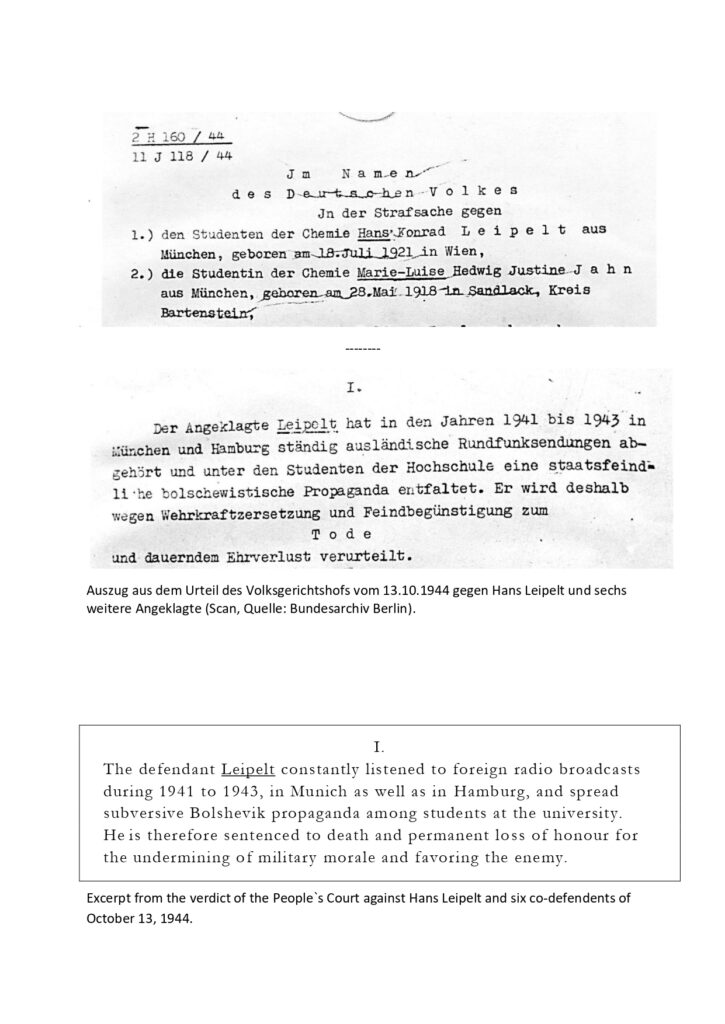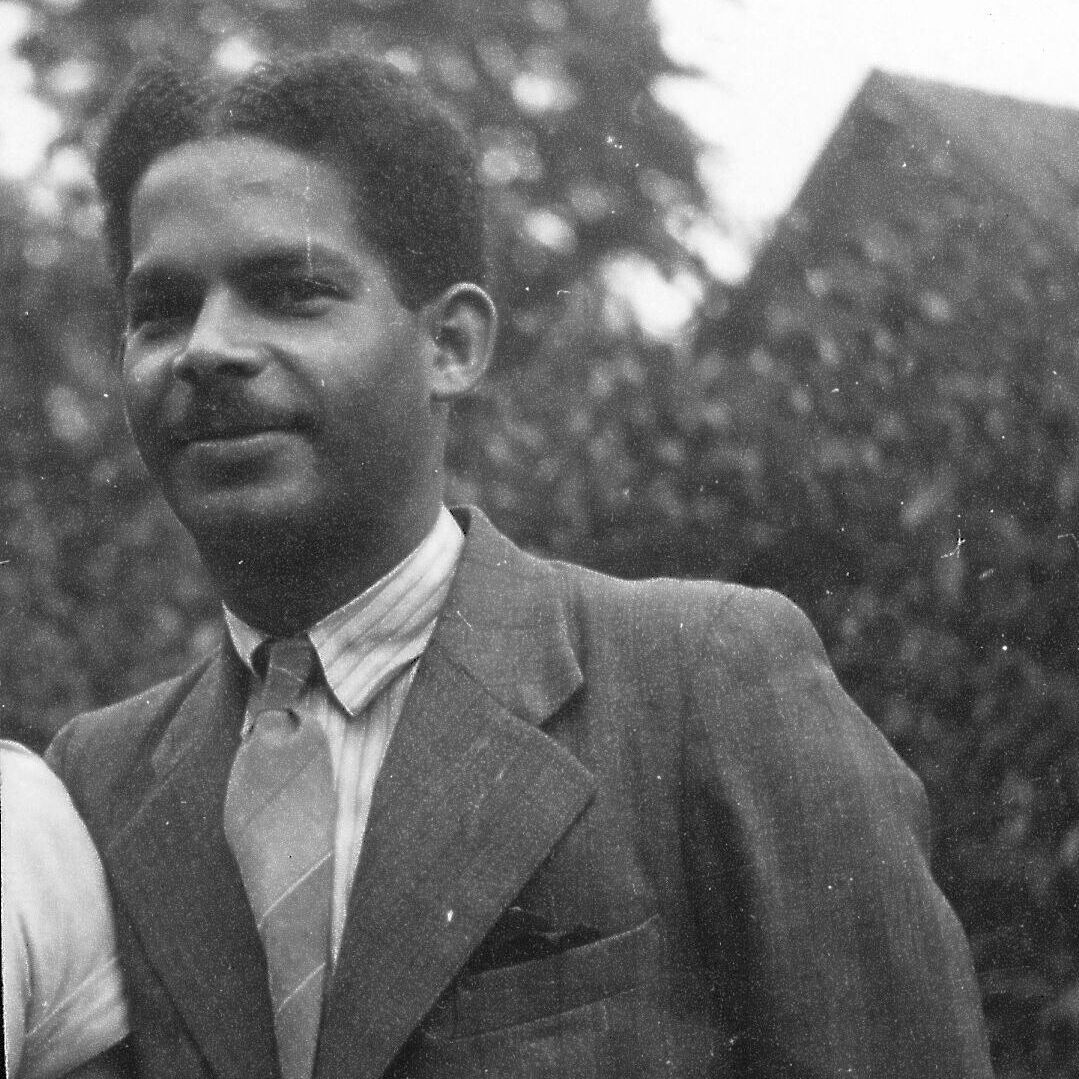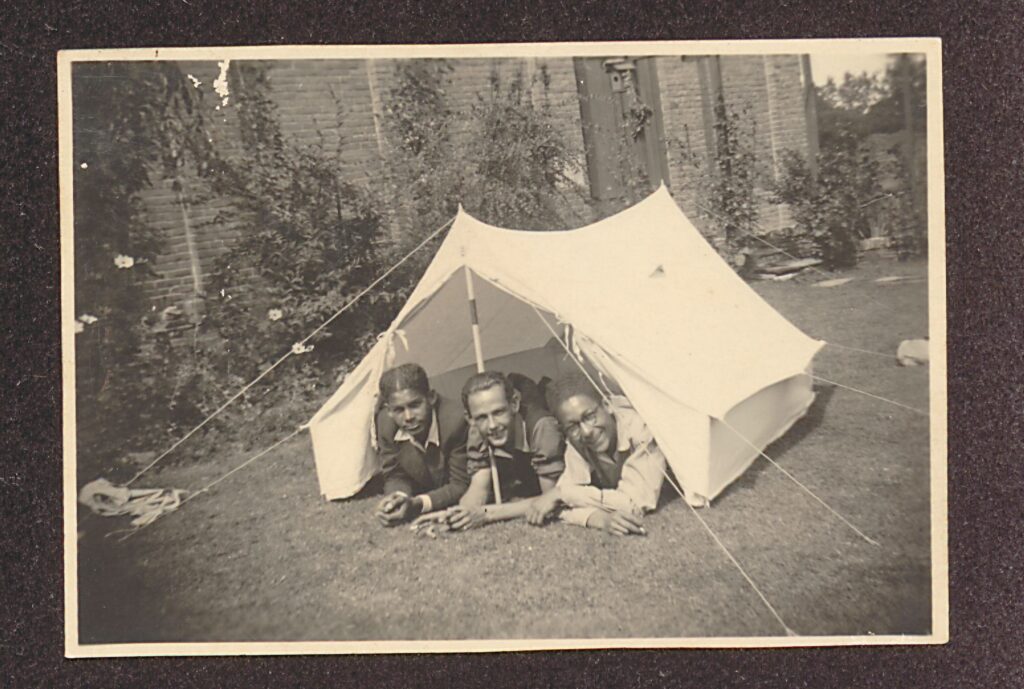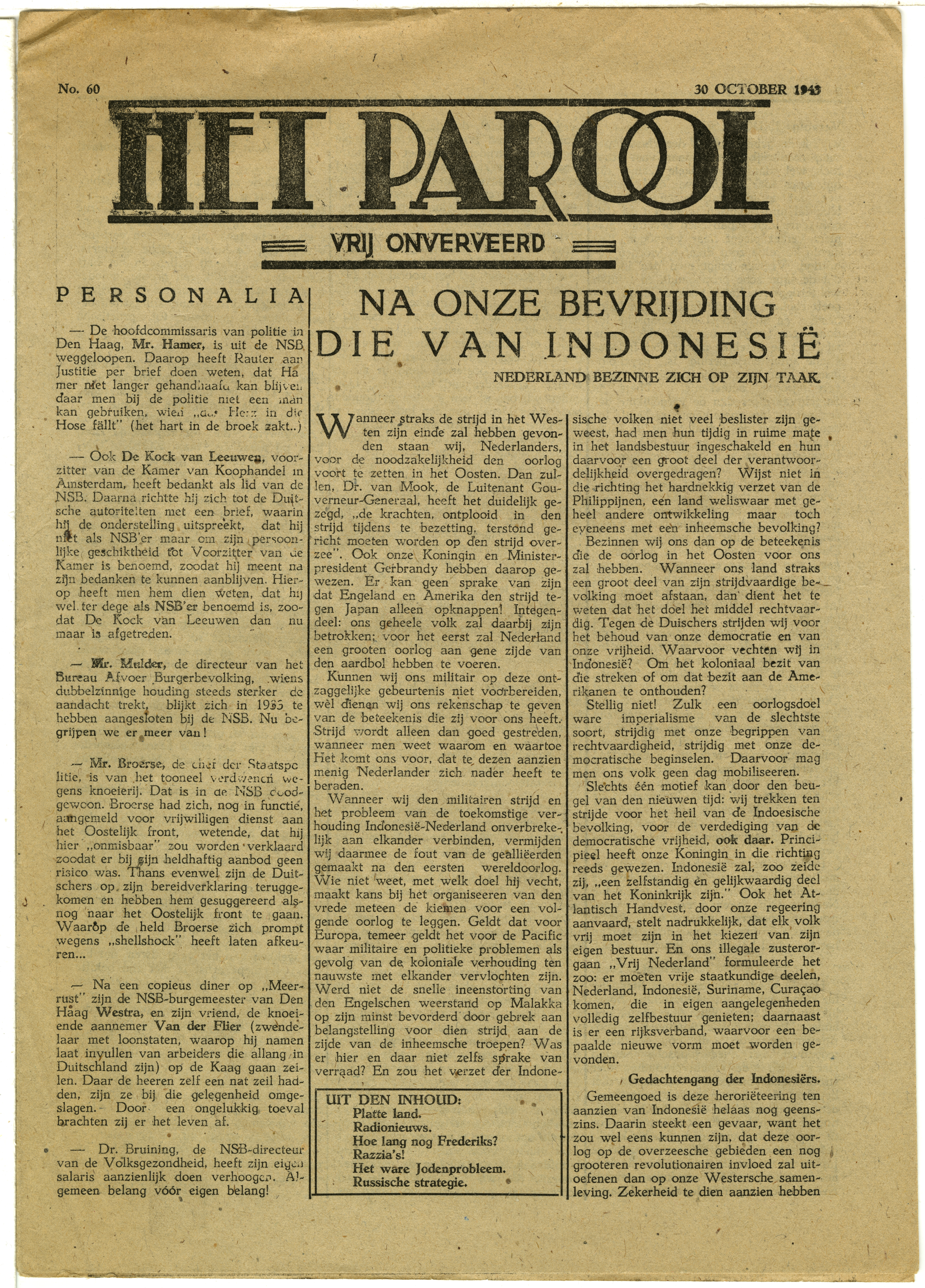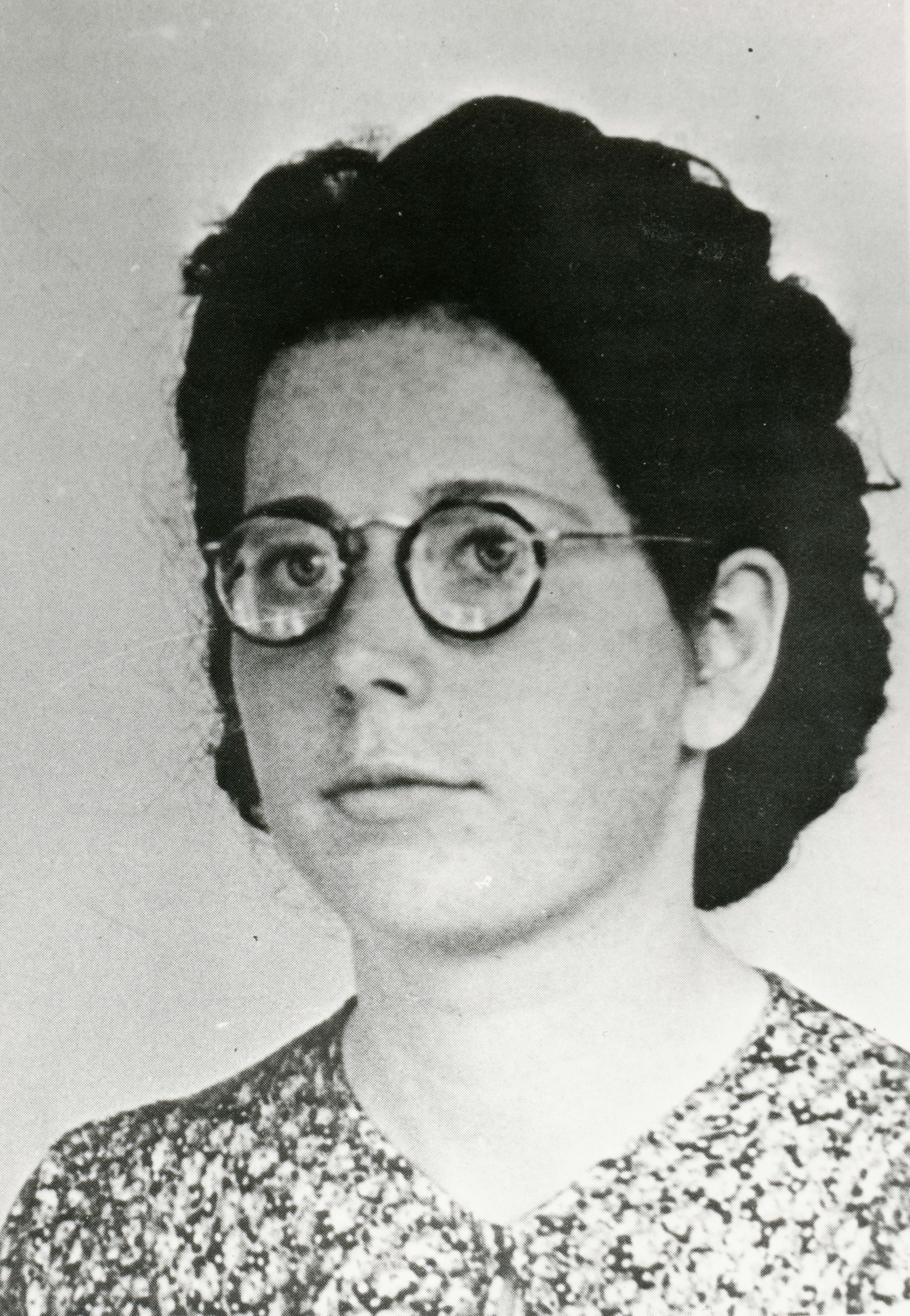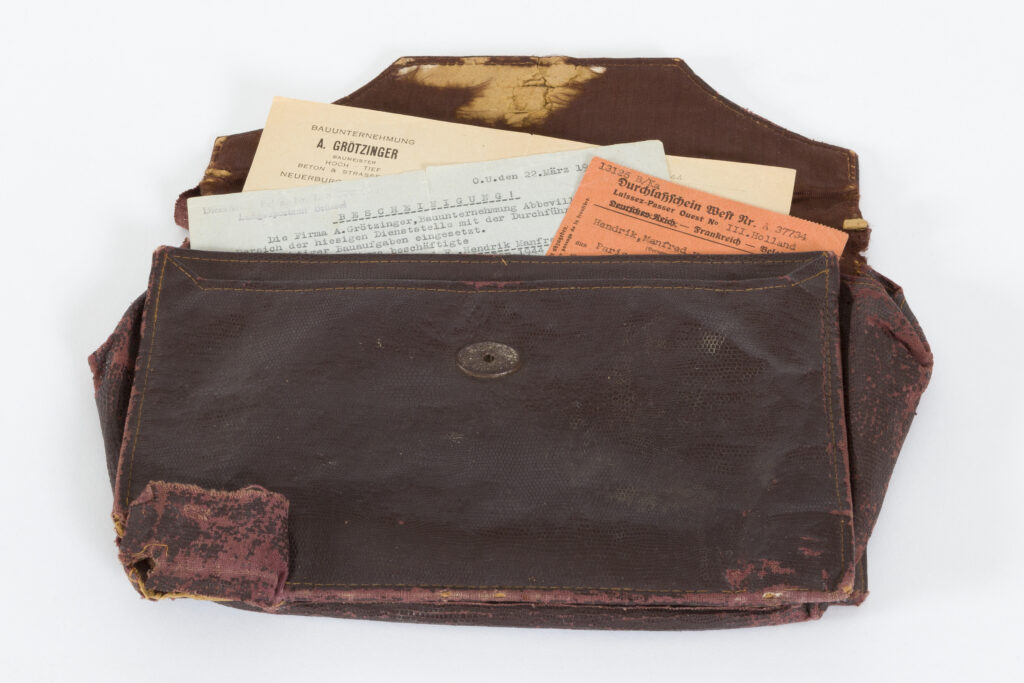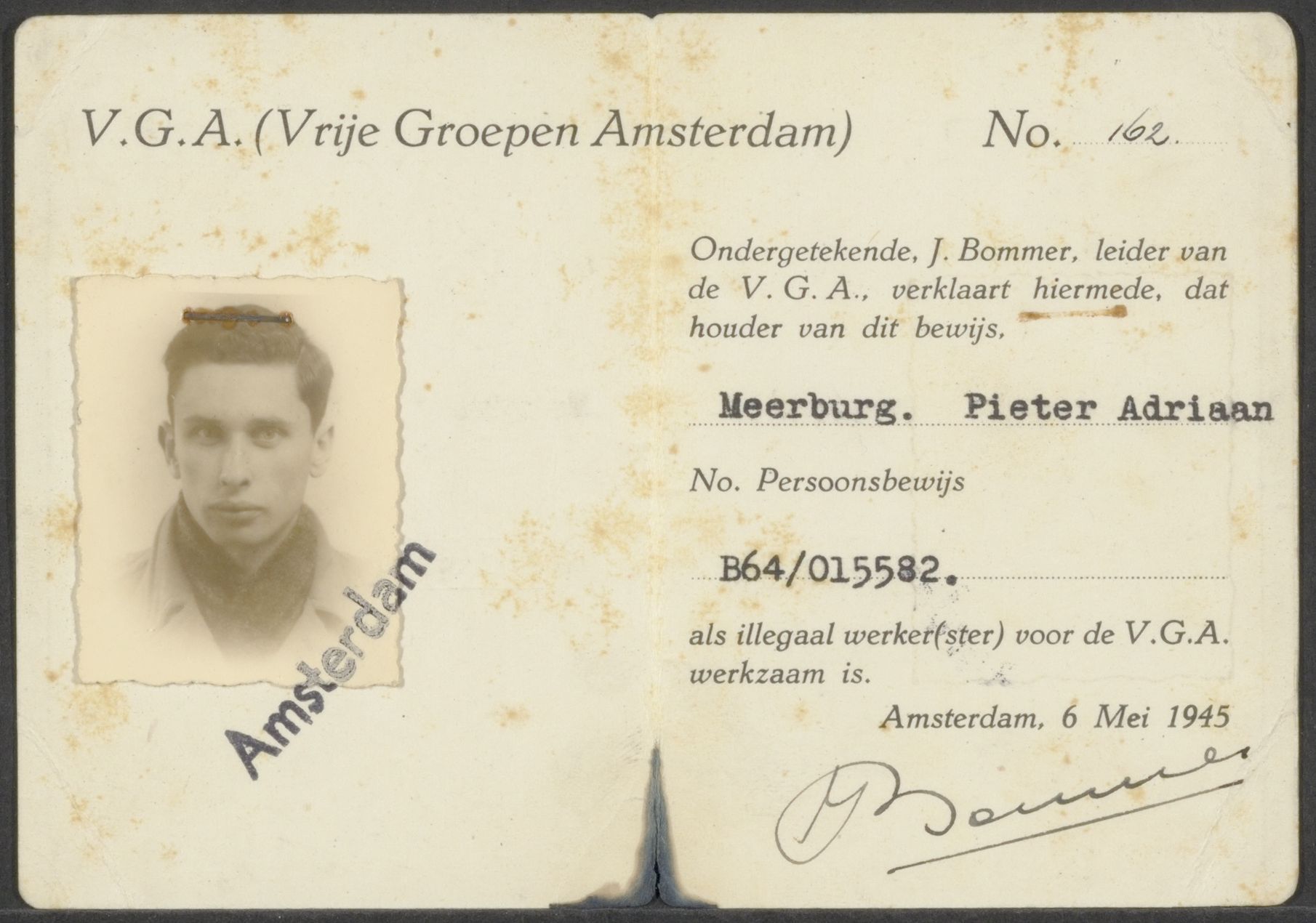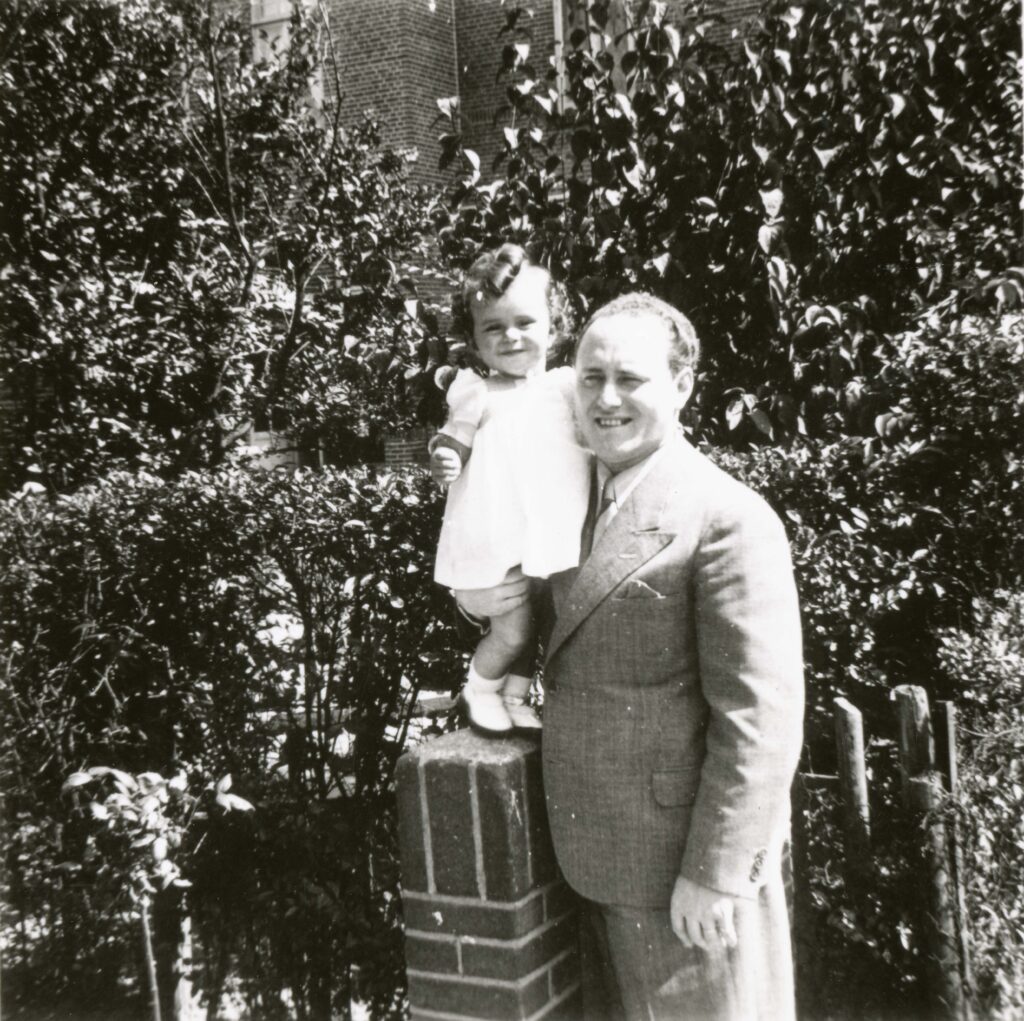Hans Leipelt war Student in München. Am Tag der Verhaftung der Geschwister Scholl erhielt er ein Exemplar des sechsten Flugblattes der Weißen Rose. Er und seine Freundin Marie-Luise Jahn schrieben es mehrfach ab und verteilten es, mit dem Zusatz “…und ihr Geist lebt trotzdem weiter”.
Hans Leipelt wurde am 18. Juli 1921 in Wien geboren. Seine Mutter stammte aus einer christlichen Familie jüdischer Herkunft. Hans Leipelt und seine Schwester Maria, die nach dem Umzug nach Hamburg im Jahr 1925 geboren wurde, wurden protestantisch erzogen. Die antisemitischen Nürnberger Rassegesetze stigmatisierten die Geschwister 1935 als “jüdische Mischlinge ersten Grades” und die Mutter als “privilegierte Volljüdin”. Durch den Tod von Hans Leipelts Vater 1942, dem einzigen “arischen” Familienmitglied, wurden sie schutzlos.
Nach dem Reichsarbeitsdienst trat Hans Leipelt in die Wehrmacht ein und nahm 1939 am Überfall auf Polen und 1940 am Frankreichfeldzug teil. Im Juni 1940 erhielt er eine militärische Auszeichnung, zwei Monate später wurde er als “jüdischer Mischling” unehrenhaft aus der Wehrmacht entlassen. Dieser Ausschluss traf ihn tief.
Hans Leipelt begann 1940 an der Universität Hamburg Chemie zu studieren. 1941 wechselte er nach München, wo er am Chemischen Institut der LMU unter Nobelpreisträger Heinrich Wieland Schutz vor Antisemitismus fand. Am Institut traf er auf Gleichgesinnte. Sie diskutierten offen über Literatur und moderne Kunst, hörten verbotene Musik und ausländische Radiosender.
Am 18. Februar 1943 erhielt Hans Leipelt ein Exemplar des sechsten Flugblatts der Weißen Rose mit der Post und zeigt es seiner Freundin Marie-Luise Jahn. Bis dahin kannten sie die Weiße Rose und ihre Widerstandsaktionen nicht. Beide beschlossen, das Flugblatt zu vervielfältigen und weiterzugeben. In den Osterferien brachten sie Abschriften zu Freunden in Hamburg.
Am 8. Oktober 1943 sammelte Hans Leipelt Geld für die mittellose Familie von Professor Kurt Huber, der zum Tode verurteilt worden war. Die Geldsammlung wurde denunziert und er wurde von der Gestapo verhaftet. Weitere Verhaftungen im Freundeskreis in München und Hamburg folgten. Auch Leipelts Schwester Maria und seine Mutter Katharina wurden festgenommen. Katharina Leipelt nahm sich am 9. Dezember 1943 in ihrer Zelle im Polizeigefängnis Fuhlsbüttel das Leben.
Nach einem Jahr in Untersuchungshaft fand am 13. Oktober 1944 in Donauwörth der Prozess vor dem Volksgerichtshof gegen Hans Leipelt und sechs weitere Angeklagte statt. Hans Leipelt wurde zum Tode verurteilt. Er wurde am 29. Januar 1945 im Gefängnis München-Stadelheim hingerichtet.